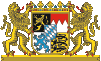Waldschutzsituation im Amtsgebiet
Der Klimawandel hinterlässt Spuren. Borkenkäfer und Pilze haben auch in diesem Jahr die Bäume geschwächt. Doch wie stark war der Borkenkäferbefall 2021, wie geht es der Kiefer und welche Pilze haben den Bäumen dieses Jahr zu schaffen gemacht?
Rückblick auf das Borkenkäferjahr 2021
Zum 30. September endete das diesjährige Borkenkäfermonitoring. Dabei handelt es sich um eine systematische Erfassung der Borkenkäferpopulation über Borkenkäferfallen in ganz Bayern. In Stadt und Landkreis Ansbach werten Förster die Fangzahlen an acht Monitoringstandorten wöchentlich aus und übermitteln die Daten an die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft.
Ein ungewöhnlich kalter April verzögerte heuer den Schwärmflug der Borkenkäfer. Zwar startete das Borkenkäfermonitoring wie immer pünktlich zum 1. April, doch der winterliche Frühling sorgte dafür, dass die Käfer vielerorts nur zögerlich ausschwärmten.
Ein ungewöhnlich kalter April verzögerte heuer den Schwärmflug der Borkenkäfer. Zwar startete das Borkenkäfermonitoring wie immer pünktlich zum 1. April, doch der winterliche Frühling sorgte dafür, dass die Käfer vielerorts nur zögerlich ausschwärmten.
Mit sommerlichen Temperaturen Anfang Mai begannen die Borkenkäfer dann verstärkt mit dem Schwärmflug. Die Aktivität beim ersten Schwärmflug war so konzentriert wie seit 2015 nicht mehr. An den Monitoringstandorten in Mittelfranken wurde bereits im Mai die Warnschwelle für einen Stehendbefall (3.000 Buchdrucker/Falle/Woche) überschritten. Die hohen Sommertemperaturen trugen dazu bei, dass die Gefährdungslage in Mittelfranken ab Mitte Juni überwiegend im roten Bereich lag.
Die Borkenkäferschäden fielen durch die günstige Witterung in diesem Jahr zwar weniger heftig aus als in den vergangenen Hitze- und Trockenjahren. Eine Entwarnung ist aber nicht angebracht. Nach wie vor entstanden neben vielen kleinen Befallsherden auch größere Kahlflächen. Aufgrund der hohen Ausgangspopulation muss auch in den nächsten Jahren mit verstärkten Borkenkäferbefall gerechnet werden.
Die Rinde stark befallener Fichten sitzt aktuell besonders locker. Zum Teil fällt die Rinde bereits vor dem ersten Frost ab. In diesem Fällen verlassen die Käfer oft die abgefallenen Rindenstücke und ziehen sich zur Überwinterung in den Boden zurück. Dort sind die Käfer nicht mehr zu erreichen. Wir appellieren daher an alle Waldbesitzerinnen und Waldbesitzer ihre Fichtenwälder weiterhin aufmerksam auf Borkenkäferbefall zu untersuchen und befallene Bäume rechtzeitig waldschutzwirksam aufzuarbeiten.
Auf der Homepage „Borkenkäfermonitoring in Bayern“ der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft finden sich viele nützliche Informationen über den Borkenkäfer und dessen Monitoring. Hier können zum Beispiel Ergebnisse für einzelne Fallenstandorte abgerufen werden.
Waldschutzsituation bei der Kiefer
Bereits seit mehreren Jahren können im Amtsbereich absterbende Waldkiefern beobachtet werden. Die Schäden treten überwiegend an Waldrändern und Hangbereichen auf, insbesondere wenn diese südlich bzw. westlich exponiert sind. Auch hier traten die Schäden in diesem Jahr weniger stark als in den vergangenen Hitze- und Trockenjahren auf. Mit der Klimaerhitzung steigt das Anbaurisiko der Kiefer deutlich an. In Zukunft muss damit verstärkt mit dem weiteren Absterben von Kiefern gerechnet werden. In den sich auflichtenden Beständen stellen sich dann schnell Schwarzdorn, Faulbaum, Brombeere, etc. ein, die die weitere Bewirtschaftung erschweren. Ein rechtzeitiger Umbau der Kiefernbestände, am besten unter dem Schirm der Altbäume, ist daher sehr empfehlenswert. Ihre zuständigen Försterinnen und Förster beraten Sie gerne.
Pilze an Laub- und Nadelholz
In den letzten Jahren litten die Bäume eher an durch Hitze und Trockenheit verursachte Pilzschäden, wie zum Beispiel der Rußrindenkrankheit am Ahorn. Die üppigen Niederschlagsmengen führten dieses Jahr hingegen zu einem starken Auftreten von Blatt- und Schüttepilzen.
An der Esche ist es im Jahresverlauf zu einem teils massivem Neubefall mit den Sporen des Pilzes Hymenoscyphus fraxineus gekommen, der verantwortliche Pilz für das Eschentriebsterben. Im kommenden Frühjahr ist mit einem vermehrten Absterben der Bäume zu rechnen und einem damit verbundenen erhöhten Verkehrssicherungsaufwand.
An der Esche ist es im Jahresverlauf zu einem teils massivem Neubefall mit den Sporen des Pilzes Hymenoscyphus fraxineus gekommen, der verantwortliche Pilz für das Eschentriebsterben. Im kommenden Frühjahr ist mit einem vermehrten Absterben der Bäume zu rechnen und einem damit verbundenen erhöhten Verkehrssicherungsaufwand.
Beim Ahorn wurden besonders in jungen, dichten Beständen Blattverfärbungen bis hin zur Blattwelke beobachtet, zurückzuführen auf die Teerfleckenkrankheit und die Weißfleckigkeit. Bislang wurden dadurch jedoch keine forstwirtschaftlichen Ausfälle verursacht.
Beim Nadelholz konnten besonders in dichten Fichten- und Douglasienbeständen vermehrt die Fichtennadelröte und die Rußige Douglasienschütte beobachtet werden. Ein starker Befall beeinträchtigt die Vitalität der Bäume.
Insgesamt sollte sowohl beim Nadelholz als auch beim Laubholz darauf geachtet werden, dass insbesondere Jungbestände regelmäßig gepflegt werden, um die Luftzirkulation in den Beständen durch eine Reduktion der Baumzahl zu verbessern und so einen Pilzbefall zu vermindern.